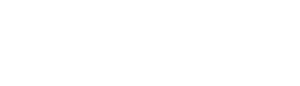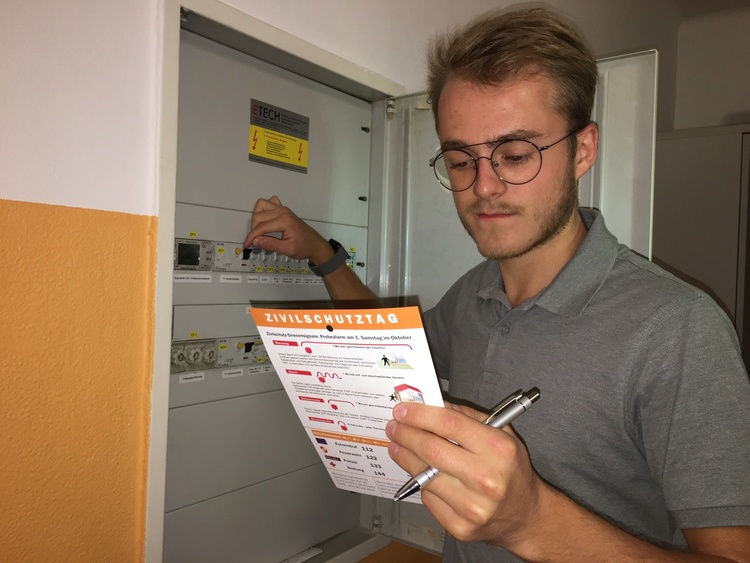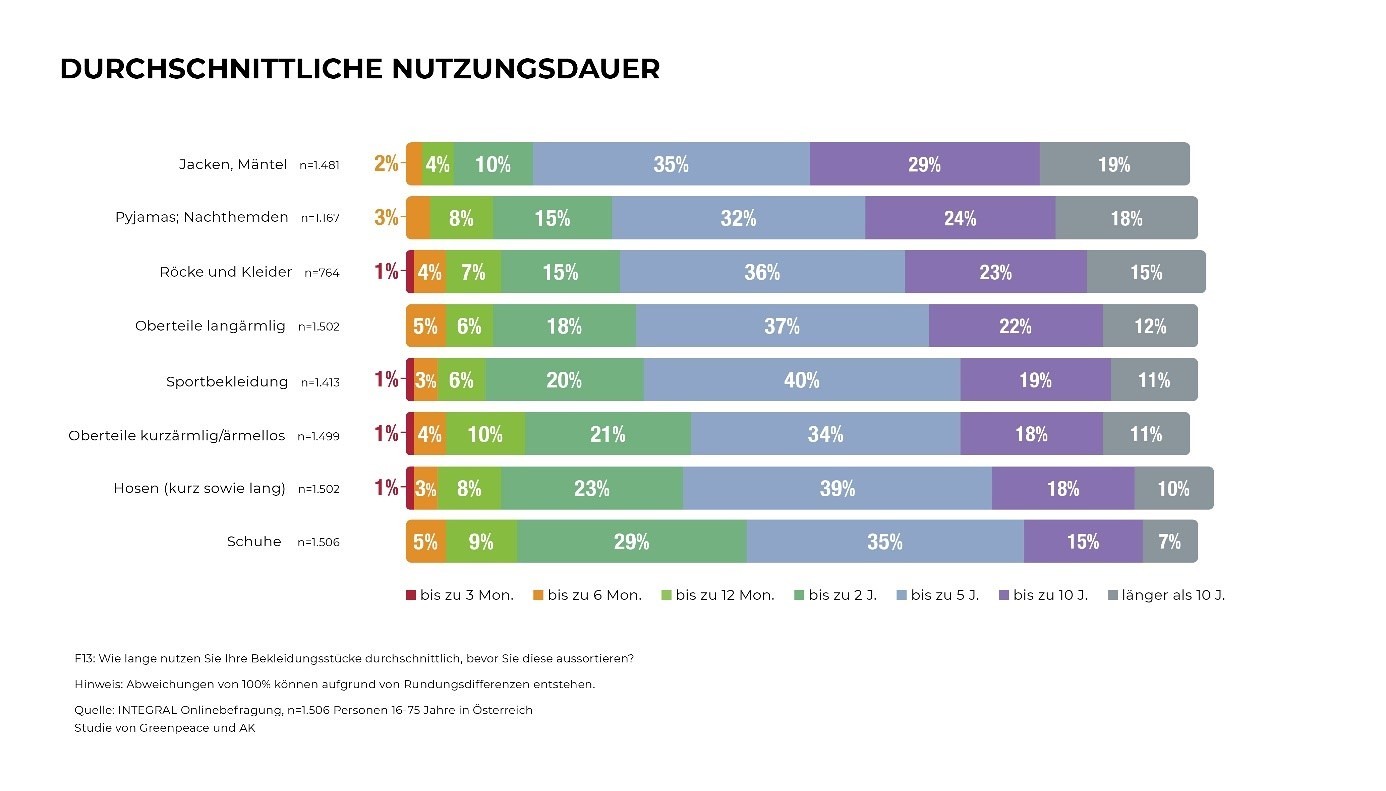Ein GEschenk für die Umwelt: das war die wefair 2025!
Die 20. ausgabe der WeFair lockte von 7. bis 9. November mehr als 7.000 Menschen ins Design Center Linz: Über 160 Ausstellende präsentierten auf Österreichs größter Nachhaltigkeitsmesse faire Mode, biologische Delikatessen und ökologische Accessoires – die perfekten Geschenke, um sich und seinen Liebsten eine Freude zu machen.